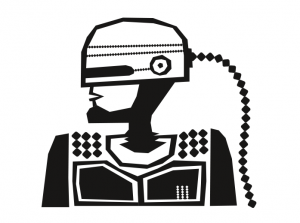JVC RC-M90 oder Sharp GF-777: Sie waren die ungekrönten Könige der späten 1970-er und der 1980-er Jahre. Sie waren mit Tragegriff versehene Hi-Fi-Anlagen der Sonderklasse: 10 bis 15 Kilo schwer und mit bis zu 100 Watt Leistung, und sie pflegten Batterien zu fressen wie Kühe Gras. Mit ihrer Soundgewalt vermochten sie ganze Strassenzüge leerzufegen; nicht umsonst nannte man sie auf Englisch boombox oder ghetto blaster – von Englisch to blast, «in die Luft jagen». Tragbar waren sie mit Einschränkungen – mit mehr oder weniger elegantem Schwung pflegte sich der breaker die koffergrossen Kraftwerke auf die Schulter zu wuchten, um anschliessend mit rhythmischem Hüftschwung die hämmernden Bässe durchs Viertel zu tragen.

Die «Rock Steady Crew», 1977 in der New Yorker Bronx entstanden, war eine dieser Gruppen. Ihre Tanzakrobaten mit Fantasienamen wie «Crazy Legs» oder «Frosty Freeze» trugen dazu bei, dass aus dem New Yorker Hip-Hop eine weltweite Bewegung wurde – und die Soundmaschine namens Ghettoblaster zum Statussymbol.